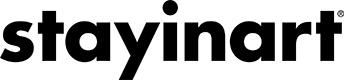Ein Fuck You an alle Abramović-Erwartungen.
Die Geschichte der weiblichen Performance, genauer gesagt der feministischen Performance, ging immer wieder durch markante Passagen des Schmerzes und Leidens. Der eigene Körper wurde bei allen Geschlechtern zu einem favorisierten Material, mit dem streng und strapaziös umgegangen wurde. Auch Männer fügten sich für die Kunst Wunden und Schmerzen zu. Es sind jedoch die weiblichen Performances, etwa von Yoko Ono, Gina Pane oder Carolee Schneemann, die die körperlichen Strapazen in der politischen und soziokulturellen Kunstgeschichtsschreibung unwiderruflich festgeschrieben haben – weit über eine »nur« feministische Kunstgeschichte hinaus. Marina Abramović repräsentiert dieses ikonische Bild wohl am stärksten. In ihrer Autobiografie schrieb sie, »dass der Schmerz so etwas wie eine heilige Tür zu einem anderen Bewusstseinszustand« sei.
Heute, in den Zwanzigerjahren des 21. Jahrhunderts, hat sich vieles verändert. Künstlerinnen können sich von diesem Schmerz dank der unverzichtbaren Vorreiterinnen befreien, die viel von ihrem Körper, ihrer Intimität und ihrer Gesundheit hergaben, um die einst marginalisierte Frauenrolle in der bildenden Kunst grundlegend neu zu schreiben. Sophia Süßmilch, Performancekünstlerin und Malerin, steht in diesem Erbe für eine neue Generation, die nun auch mehr Humor, Selbstironie und Verspieltheit einsetzen darf bzw. will und dabei trotzdem nicht befürchten muss, die Stärke ihrer Haltung oder die Ernsthaftigkeit der Rezeption zu gefährden.
In ihrer Ausstellung Sanatorium Süßmilch wird sie dreißig Tage im Francisco Carolinum in Linz wohnen. Besucherinnen haben täglich nur zwei Stunden Zugang zu den Räumlichkeiten, montags ist geschlossen. Während ihrer Anwesenheit wird Süßmilch eineinhalb Stunden lang massiert. Die Besucherinnen können sich unter ihren Massagetisch hocken oder legen – sofern sie das wollen – und ein Gespräch mit der Künstlerin führen. Ihr Gesicht wird durch das Loch des Tisches gedrückt zu sehen sein; eine eigentümliche Haltung für eine Konversation – für beide Seiten. Vielleicht wird es etwas unangenehm; aber eher für die Künstlerin, die sich nun alles anhören muss. Oder auch nicht; vielleicht wird sie auch ein Nickerchen machen. Eine Sauna steht ihr ebenfalls zur Verfügung, jedoch ohne Besucherinnen. Statt Schmerz also Massage, statt Leid Self-Care. »Die Abramović-Erwartungen, die man besonders an eine weibliche Performance hat, werden nicht erfüllt«, stellt Süßmilch mit mir im Gespräch klar.
Schlafen wird sie in der Installation Deep fried woman, einem »Vagina-dentata-Bett«, wie sie es nennt. Ein Nest, ein kleiner Raum, ein Meter fünfzig hoch und nur über eine Schwimmbadtreppe zu betreten. Innen sind die Wände blau und mit Zähnen behangen, wie ein Sternenhimmel. Auf der runden Matratze wird Sophia die Nächte verbringen. Wahrscheinlich ohne Muskelverspannungen, die wohl häufigste Nebenwirkung von Performances – die Masseurinnen helfen. Sophia Süßmilch steht für eine zeitgenössische Kunst, die feministisch, provokant und konsequent ist, aber in der auch das Augenzwinkern wie ein dreister Joker im Spiel der Kunstwelt selbstbewusst auf den Tisch gelegt wird. Das Sanatorium Süßmilch nennt die Künstlerin auch einfach »Irrenanstalt« – ein liebevoller und gruseliger Titel zugleich. In sorgsamer Manier hat sie sich eingerichtet, ihr Bett gebaut und Vorkehrungen zur Verpflegung getroffen. Sie engagiert auch Wächterinnen, die sie vor eventuellen Übergriffen schützen, wenn sie nur mit einer Unterhose bekleidet auf einem Massagetisch liegt und Besucherinnen ein und aus gehen. Das Museum und ihre Ausstellung werden zum Rückzugsort für Heilung und Ruhe, zum Malen und Schlafen.
In dem Titel »Sanatorium« steckt aber auch die dunkle Geschichte der Psychiatrie; man denke an die Zeit des Nationalsozialismus und der NS-Euthanasie. In den 1930er-Jahren kam auch die Elektroschocktherapie auf, die durch den Film Einer flog über das Kuckucksnest nachdrücklichen Eingang in das kollektive Gedächtnis fand. Ein Verfahren, das besonders in dessen Anfängen während der Nazipsychiatrie, aber auch noch in der DDR für Missbrauch, Bestrafung und Folter eingesetzt wurde. Das sind aber nicht die einzigen dunklen Kapitel in der Geschichte der Psychiatrie. Auch die Zwangseinweisungen der Frauen im 19. Jahrhundert zählen dazu. Lange Zeit konnten Ehemänner über den psychischen Gesundheitszustand ihrer Frauen urteilen und diese einliefern lassen – natürlich gegen deren Willen. Die Wissenschaftsjournalistin Ruth Kuntz nennt in ihrem Artikel »Frauen, das verrückte Geschlecht?« nur wenige von tausenden Beispielen. Sie erinnert an eine Ehefrau aus Pennsylvania, deren Mann sie einweisen ließ, »weil sie sich selbst vernachlässige und sexuell verweigere«. Zur Psychiatriegeschichte gehören natürlich auch die »Diagnosen« der hysterischen Gebärmutter, letztlich noch vom britischen Historiker Roy Porter als »biologische Folklore« betitelt.

Besucher:innen in der Ausstellung Sanatorium Süßmilch 10.10.23 – 28.01.24 Francisco Carolinum Linz © Michael Maritsch


Wenn Sophia Süßmilch ihre eigene Irrenanstalt einrichtet – und das eben nicht als Patientin, sondern aus ihrem Künstlerinnenstatus, das heißt aus einer eigenständigen, privilegierten Position heraus –, dann handelt es sich um ein Zurückholen von Selbstbestimmung und um die Aneignung von etwas, das sich historisch besonders für viele Opfer jeder Aneignung verschloss. Auch ihren Tagesablauf legt sie selbst fest. Ihr Plan sieht beispielsweise folgendermaßen aus: 9:00 Uhr Urschreiyoga, 9:30 Uhr Kunsttherapie, 10:00 Uhr Zigaretten und dabei Therapie mit sich selbst, 10:30 Uhr erster Saunagang. Als Patientin verordnet sie sich selbst, was ihr guttut – in ihrem Fall Massagen und Saunagänge. Auch diese Praxis ist nach der Erinnerung an die dunkle Geschichte der Psychiatrie nicht nur ein Spaß, nicht nur ein »Fuck you« an alle Abramović-Erwartungen, sondern auch ein »Fuck you« an das alte Patriarchat; an alle Ehemänner, die ihren Frauen durch die Einweisung großes Leid zugefügt haben. Und natürlich an alle Uterusgelehrten.
Sophia Süßmilch baut sich ihre eigene Uteruswelt und bespielt diese gemeinsam mit ihrer Mutter. Beide agieren als Protagonistinnen der Performance Uterusparfait. Nach einem schwitzigen Saunagang werden sie zu einem Tonbeet gefahren und auf dieses gehoben. Währenddessen ziehen zwanzig Darstellerinnen sich aus, vorher als Besucherinnen verkleidet. Nackt holt sich jede ein Spekulum – jenes Instrument, das bei medizinischen Untersuchungen die Vagina öffnet. Mit diesen Spekuli graben die zwanzig Helferinnen Mutter und Tochter in den Ton ein. Nur ihre Gesichter bleiben frei. Sie sitzen sich gegenüber, eingehüllt in die Erdmaterie, zurückgekehrt in die Gebärmutter, an den Ort der Schwangerschaft, der Mensch- und Daseinswerdung. Dort, wo vielleicht schon das Schicksal bestimmt wird, wo die Gene sich mischen, wobei diese auch Defekte bekommen können. Bei dieser Reise – geführt von dem Spiel einer Geigerin – bleibt offen, ob es die Mutter ist, die ihre Tochter zurückholt und sie dieses Mal Auge in Auge durch eine unterbewusste, pränatale Erinnerung begleitet, vielleicht sogar ihre Prägungen aufdecken wird. Oder ist es die Tochter, die ihre Mutter in sich aufnimmt und ihr den Schutz der Gebärmutter zurückgibt, sie ernährt und wiegt? Vielleicht ist es aber auch eine Rückkehr für beide. Eine Reise zum Ursprung des Ichs, aber in einem dritten Uterus. So, als würde jene ungleiche Abhängigkeit aufgehoben, die eine Mutter und ihr Baby anfangs wie ein Naturgesetz verbindet. Das gemeinsame Erleben der Abhängigkeit sorgt jetzt – und vielleicht nur so – für eine befreiende, verbundene Unabhängigkeit. Statt des klassischen, großen Topos des Todes wird in Sanatorium Süßmilch die Geburt thematisiert. Ein Thema, das in der langen männlichen Philosophiegeschichte kaum vorkam. Der Tod hingegen schon. Er gehört zu den beliebtesten Reflexionsobjekten der Männer, eben weil sie keinen Uterus haben und ihnen somit nur der Blick in den Tod als Sinnstiftung übrig bleibt. Ein Missverständnis also, eine männliche – absichtliche – Fehldeutung, die vorgibt, dass der Tod komplexer oder denkwürdiger sei als die Gebärmutter. Denn was kann komplizierter oder wichtiger für die Welt, die Menschheit, das Ich und die Sinnstiftung sein, als das, was der Uterus als Phänomen repräsentiert?
Zu weiteren Fragen und Welträtseln gelangt Sophia Süßmilch durch die Ergebnisse einer ihrer Ausstellung vorangegangenen Recherchearbeit: die Suche nach Lösungen für die ganze Welt, am liebsten auf eine einzige Weltlösungsformel gebracht. Diese wird von ihr während der Ausstellung bzw. ihrer Selbsteinweisung in die Irrenanstalt mithilfe einer überdimensionalen Mindmap erstellt werden, vier mal zehn Meter groß. Für diese Arbeit wählte sie sechsundzwanzig Gesprächspartnerinnen aus, davon fünfundzwanzig Frauen. Allen stellte sie die gleichen Fragen, alle Antworten nahm sie auf Video auf. Die Szenen werden auf Monitoren präsentiert. Welchen Sinn hat Kunst, wenn die Welt untergeht? In welche Abschnitte kann man das Leben unterteilen? Inwieweit ist die kindliche Prägung für das spätere Leben entscheidend? Wie würde ein gerechtes Leben für alle aussehen? Woher kommt die Angst vor dem Tod, und wie kann man sie besiegen? Die Antworten fallen unterschiedlich aus. Auch komplette Wiedersprüche sind dabei – natürlich, sind es doch Fragen, die selbst unter Wissenschaftlerinnen oder Philosophinnen kontrovers diskutiert werden, und in deren Fragenatur es liegt, dass sie wahrscheinlich – zumindest von einem menschlichen Gehirn – niemals eindeutig gelöst werden können. Die Arbeit an der Weltlösungsformel ist also eine Arbeit, die zum Scheitern führen wird. Und so ist es auch gewünscht. Die Tragik, sich mit den großen Lebensfragen herumzuplagen und doch allerhöchstens nur punktuell zu kleinen, individuellen Erkenntnissen sowie zu schmalen Befriedigungen zu gelangen, wird in Süßmilchs Art mit Ironie aufgenommen. Und dann ist auch erstmal wieder Zeit für eine Massage.
Ihr Ansatz steht konträr zu jenen Ansätzen des 20. Jahrhunderts. Von der Avantgarde der Moderne bis zu Abramović gab es immer wieder Ambitionen und Haltungen, die behaupteten, zu wissen, was richtig und was falsch ist, was möglich ist und was nicht und wie man »richtig« leben solle. Süßmilch eröffnet keine Schule, keine Akademie und bietet keine Workshops an. Oder, um es mit aktuelleren Worten auszudrücken: Sie sucht und verspricht keine Selbstoptimierung. Vor den großen Fragen steht sie genauso ratlos oder nachdenklich da wie die Besucherinnen.
Das Sanatorium bietet viel und eben doch nicht alles. Genau diese Unvollkommenheit, das Scheitern an der Weltlösungsformel, mag die stärkste Botschaft sein. Die Künstlerin allein und die Kunst an sich können den Planeten oder die Menschheit nicht retten. Dafür braucht es mehr – interdisziplinäre Wissenschaftskooperationen, Politik, Unternehmen, Menschen, Staaten. Self-Care hängt ebenfalls von finanziellen, zeitlichen und soziokulturellen Privilegien ab. Alldem ist sich Sophia Süßmilch bewusst, all das macht sie deutlich. Insofern ist ihr Sanatorium sehr reich – reich an Verspieltheit, reich an Ernsthaftigkeit, reich an Wahrhaftigkeit.